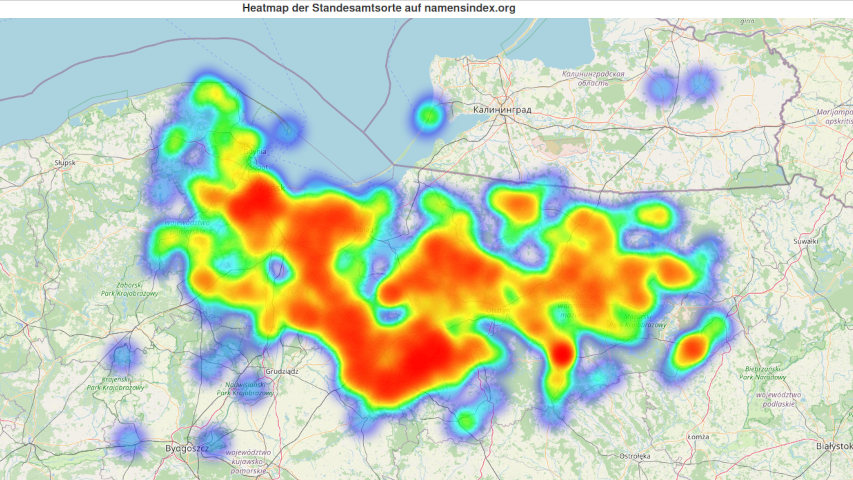Änderungen im Personenstandsgesetz vom 3. November 1937
05.11.2025, Bernhard Ostrzinski
Bereich: Wissenswertes für die Familienforschung
Das Personenstandsgesetz von 1874 wurde durch ein neues Personenstandsgesetz von 1937 ersetzt.

Mit diesem Gesetz wurde eine neue Regelung für die Führung der Register durch die Standesbeamten festgelegt. In unserem Projekt wurde das Familienbuch (nicht zu verwechseln mit dem „Stammbuch”) unter der Rubrik „Aufgebote/Belege” indiziert und in einigen Standesämtern in den letzten Jahren neben weiteren Dokumenten erfasst.
Familienbuch (Deutschland) (Wikipedia)
Das Personenstandsgesetz vom 3. November 1937 trat am 1. Juli 1938 in Kraft und ersetzte das Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstands und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 (§ 71 PStG 1937). Nach dem Reichsgesetz mussten von jedem Standesbeamten drei Standesregister unter den Bezeichnungen Geburtsregister, Heiratsregister und Sterberegister geführt werden (§ 12 des Gesetzes vom 6. Februar 1875). An die Stelle des Heiratsregisters trat das Familienbuch, das den verwandtschaftlichen Zusammenhang der Familienangehörigen deutlich machen sollte (§ 2 Abs. 1 PStG 1937). Bei einem Wechsel des religiösen Bekenntnisses mussten der Ein- bzw. Austritt vor dem Eintrag in das Familienbuch nachgewiesen werden.
Zum Nachweis ihrer Ehefähigkeit hatten nichtjüdische Verlobte ein Ehetauglichkeitszeugnis beizubringen (§ 5 Abs. 2 PStG 1937 in Verbindung mit § 17 der Ersten Ausführungsverordnung).
Zum Nachweis ihrer Ehefähigkeit hatten nichtjüdische Verlobte ein Ehetauglichkeitszeugnis beizubringen (§ 5 Abs. 2 PStG 1937 in Verbindung mit § 17 der Ersten Ausführungsverordnung).
Das Familienbuch bildete somit die familiäre Herkunft über drei Generationen ab: Neben den Eheschließenden selbst waren auch deren Eltern und Kinder erfasst.
[14] Durch die systematische Erfassung der Eheschließenden sollte innerhalb eines Zeitraums von dreißig Jahren die rassistische Einordnung fast aller im Deutschen Reich lebenden Menschen aus den Familienbüchern ersichtlich sein.
1958 änderte sich das Familienbuch und wurde auf einem Kartonblatt im DIN-A4-Format geführt, sodass es kein Buch im klassischen Sinne mehr war.
Ihm lag jedoch ein ähnliches System zugrunde: Auch hier waren die Daten zur Eheschließung der eigentliche Kerneintrag, der um Angaben zu den Eltern der Ehegatten und ihren gemeinsamen Kindern ergänzt wurde. Diese weiteren personenstandsrelevanten Angaben über die Ehegatten und ihre Kinder wurden aus anderen Personenstandsbeurkundungen zusammengefasst (Sekundärbeurkundungen).
Der Sinn des Familienbuchs lag darin, dass die eheliche Familie sich beim Standesbeamten ihres jeweiligen Wohnorts mit Personenstandsurkunden ausstatten lassen konnte.
Hatten zwischen dem 1. Januar 1945 und dem 1. August 1948 derart außergewöhnliche Umstände vorgelegen, dass sich die an eine Ferntrauung gestellten formalen Anforderungen nicht erfüllen ließen, eröffnete das Gesetz über die Anerkennung von Nottrauungen vom 2. Dezember 1950²³ die Möglichkeit, eine aus diesem Grund rechtsunwirksame Eheschließung nachträglich durch Eintragung zu legitimieren.Mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 trat auch für das Beitrittsgebiet das bundesdeutsche Personenstandsgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts (Personenstandsrechtsreformgesetz – PStRG) vom 19. Februar 2007 wurde das Personenstandsgesetz von 1937 in der Fassung vom 8. August 1957 grundlegend reformiert.
Insbesondere nichteheliche Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende sahen in der Doppelbeurkundung für Verheiratete und eheliche Kinder eine Privilegierung dieses Personenkreises und forderten aus prinzipiellen Gründen die Gleichbehandlung ein. Das bisher im Anschluss an die Eheschließung anzulegende Familienbuch ist in dieser abschließenden Zusammenstellung der Personenstandsregister nicht mehr vorgesehen.
©05.11.2025 Bernhard Ostrzinski Abrufe Blogartikel: 953580
 Facebook über diesen Beitrag diskutieren!
Facebook über diesen Beitrag diskutieren!